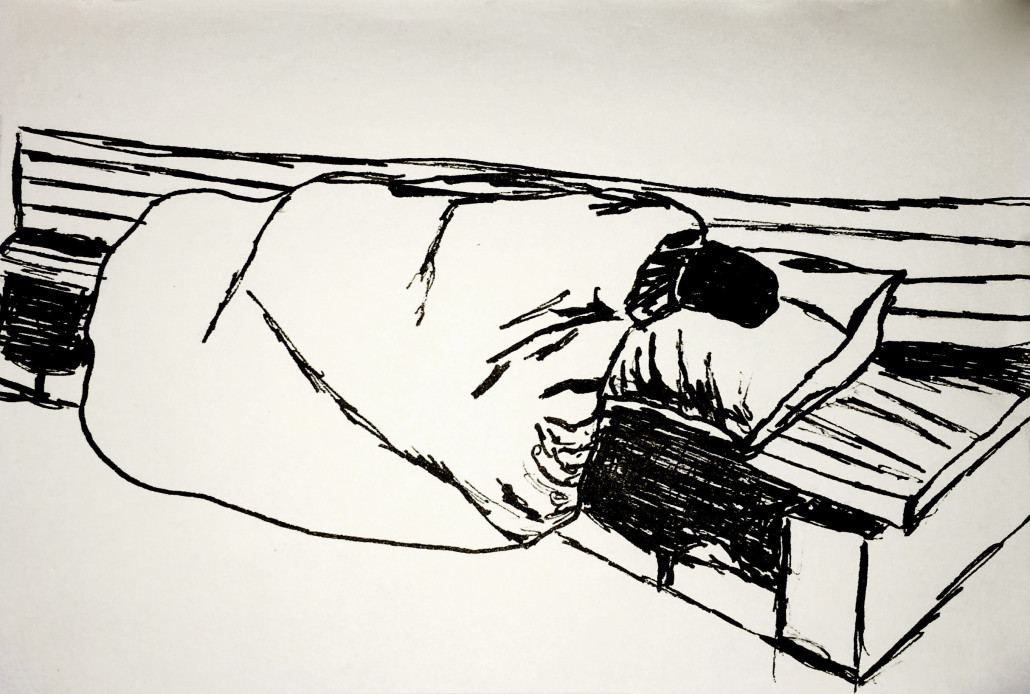Kunst kritisiert Missstände, z.B. skrupellosen Konsum. Oder würde sich immerhin sehr gut in dieser Rolle gefallen. Aber stimmt das eigentlich? Oder ist Kunst nicht selbst ein reines Konsum-Produkt, das man misstrauisch beäugen müsste – und nicht ehrfurchtsvoll bestaunen??? Eine Cross-Media-Aktion in Wil mit dem vielsagenden Titel „Shopping“ scheint nun noch bis 13. August dieser Frage nachzugehen. Und dieser „etwas andere“ Text tut das auch. Denn die Kunstgeschichte trägt das Thema „Konsum“ ja schon Jahrhunderte mit sich herum.
Shopping steht für die Möglichkeit, etwas zu konsumieren. Wo keine Ware vorhanden ist oder finanzielle Mittel fehlen, kann man nicht konsumieren, kann man nicht shoppen. Doch konsumiert hat der Mensch schon immer gerne und machte dieses auch in Kunstwerken sichtbar. Ein gutes, recht frühes Beispiel sind die niederländischen Barockstillleben um 1600: Werke mit üppig gedeckten Tafeln, exotischen Früchten und vielem mehr.

Pieter Claesz. (1597/8-1660)
Die Auftraggeber dieser Werke waren reich. Sie liebten es, das auch doppelt zu zeigen. Einmal im Abhalten von Festgelagen – oder auch durch deren Inszenierung in einem Kunstwerk. So wurde gelebter Luxus für die Nachwelt fixiert. Konsum, Luxus, Wohlstand, Kunst waren damals Dinge, die jeder gerne haben wollte. Sie waren selten, damit erstrebenswert und wer konnte, stellte sie stolz zur Schau.
Stolz geht – Scham kommt
Im Laufe der Zeit jedoch veränderte sich diese Haltung. Der Gedanke an Luxus erhielt einen schalen Beigeschmack. Mit einem Mal waren noch andere Begriffe im Raum: Überfluss, Prasserei, Gier, Ausbeutung… Diese Entwicklung beeinflusste auch die Kunst. Sie gab ihr eine neue Richtung, einen veränderten Ansatz.
Eines meiner Lieblingsbeispiele dazu kommt aus dem Jahr 1917 und ist vom französischen Künstler Marcel Duchamp. Sein berühmtes Readymade „Fontain“ ist nämlich nix weiter, als ein handelsübliches Urinal. Dieses signiert er und erklärt es zum Kunstobjekt.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp#/media/File:Fontaine-Duchamp.jpg
Mancher mag einwenden: „Das war praktisch zur Hochblüte von Dada“. Aber das ist eigentlich egal. Was mir wichtig ist: Duchamp stösst die an Edles und Bedeutsames gewohnte Kunst-Elite vor den Kopf. Er deklariert ein völlig banales und eher mit „Ekel“ konnotiertes Objekt als Kunst – einfach gekauft in einem Sanitärgeschäft: Objekt „geshoppt“ und zur Kunst erhoben. Darf man das?
Shoppen ohne Hirn
Die Idee, Kunst und Konsum kritisch miteinander zusammen zu bringen, war jedenfalls nicht mehr tot zu kriegen. Einen Höhepunkt erreicht 1961 der Künstler Claes Oldenburg. Damals eröffnet er in seinem Atelier in New Yorks Lower East Side einen Laden, The Store: Verkaufsort und Produktionsstätte zugleich. Zu kaufen gab es alles, was man im Alltag brauchte und was auch die Läden der Nachbarschaft anboten. Von Nahrungsmitteln bis zum Schuh. Mit einem Unterschied: Oldenburgs „Produkte“, egal ob Torte oder Kravatte, waren zu nichts zu gebrauchen. Jedes einzelne Stück bestand aus dem gleichen Material: mit Gips überzogenem Musselin und war farbig bemalt.

Claes Oldenburg – „Meats“
Oldenburgs warf damit Kunst-Konsum und Wirklichkeits-Konsum auf einen Haufen und hielt den Store-Besuchern einen Spiegel ihres Kaufverhaltens vor. Shoppen ohne Sinn und Verstand? Shoppen als Selbstzweck?
Heute, rund 50 Jahre später, sind wir – nicht nur in Sachen Kunst – an dem Punkt angelangt, dass wir das Wort „Konsum“ fast mit Abscheu verwenden. Unsere neuen Lieblingsworte sind solche wie Fair-Trade, Nachhaltigkeit und „biologisch“. Der Kulturphilosoph Boris Groys hat dazu einen schönen Satz formuliert: „Nichts wird in der Konsumgesellschaft so gerne konsumiert wie die Kritik am Konsum.“
Die Kunst tut auf alle Fälle ihr bestes, mitzuziehen: Verbrauchte Güter, Abfälle, Schrott usw. werden für Kunstobjekte verwendet. So versucht Kunst, sich KRITISCH mit Konsum in unserer Welt auseinanderzusetzen. Aber steht Kunst, egal in welcher Form, nicht selber für den Willen zum Konsum, den Wunsch nach Luxus? Das scheint zumindest so, wirft man einmal einen Blick auf die grossen internationalen Kunstmessen.
Griff an die eigene Nase
Zum Schluss fasse ich mir auch an die eigene Nase. Ich gestehe, dass ich trotz meines Unbehagens gegenüber ungezügeltem Konsum, Kunst und Konsum gerne in einem „Aufwasch“ geniesse. Etwa dann, wenn ich ein ermatteter Museumsbesucher bin. Nach den intellektuellen Herausforderungen, die mir die Kunst abverlangt, suche auch ich gerne Linderung beim Shopping im Museumsshop. Hier gibt es – nach dem Kontakt mit der musealen Geisterwelt des Unantastbaren, Unverkäuflichen und für mich ohnehin Unbezahlbaren – durch den realen Kaufvorgang endlich wieder eine Rückkehr ins wahre Leben. Hier kann ich alles anfassen, shoppen und mit nach Hause nehmen.
Mein Fazit
Gerade, weil Kunst und Konsum so ein spannendes und schwieriges Verhältnis zueinander haben, finde ich das „Shopping“-Projekt in Wil reizvoll. Denn wie die Kunstgeschichte zeigt: Es gab immer Kunstschaffende, die etwas Anregendes und Intelligentes aus diesem Verhältnis ziehen konnten.
In diesem Sinne: Auf nach Wil und sich eine eigene Meinung bilden! Die „Produkte“ betrachten, die von neun Kunstschaffenden im Rahmen von „Shopping“ realisiert wurden: James Stephen Wright, Martina Mächler, Lucy Biloschitski, Catherine Xu und die beiden Künstlerkollektive Nina Emge/Samuel Koch sowie Fridolin Schoch/Edmée Laurin/ Domingo Chaves .

(c) Arthur Junior- Impression von „Shopping“
Mal sehen, wie sie im Rahmen ihrer „Shopping“-Tour Kunst und Konsum gemanaget haben….
Hier gibt’s den Ausstellungsführer, genaue Daten zum Projekt und eine Besprechung dazu im Tagblatt